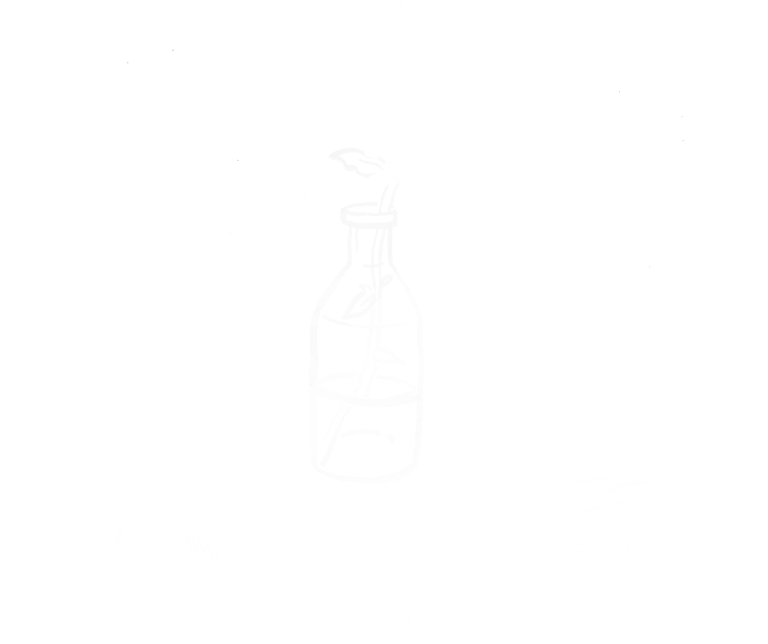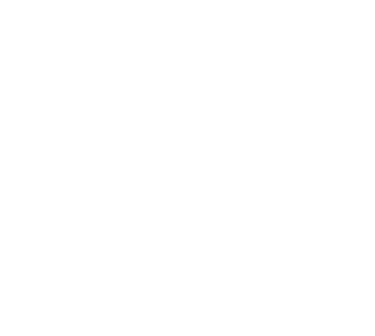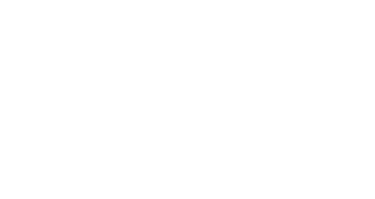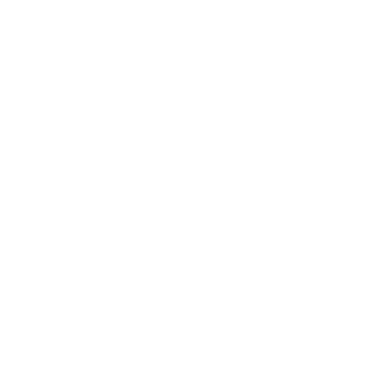


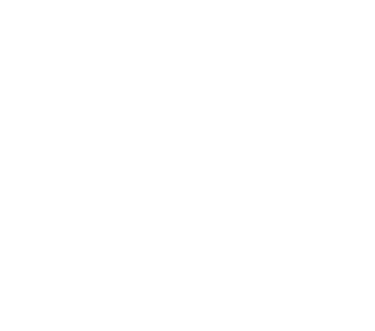


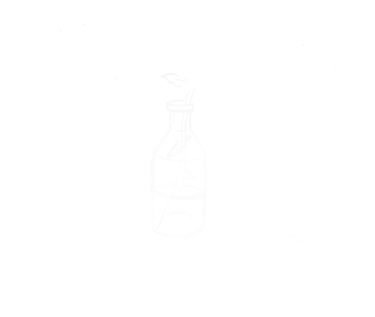


Das Licht in unseren Schatten
Dina hat alles, was man sich wünschen kann. Sie ist eine Musterschülerin und mit dem reichen Simon zusammen, dem sie blind vertrauen würde. Ihr russischer Mitschüler Alexej ist ein Schläger, bekannt als kaltblütig und eigen, und nach einem zufällig belauschten Gespräch ist Dina sicher: Er ist ihr Feind!
Doch als sie ausgerechnet mit ihm in der Schule eingesperrt wird, kommen plötzlich Fragen auf, deren Antworten sich nicht so einfach finden lassen. Dina begibt sich auf die Suche und sieht sich dabei zum ersten Mal in ihrem Leben mit Herausforderungen konfrontiert, die sie nicht nur ihr Image als ein braves Mädchen und all ihren Mut kosten könnten - sondern auch ihr Herz.
Viel Spass beim Lesen!






Kapitel 1 - Ein heimliches Gespräch
Manchmal gibt es Momente im Leben, die ganz und gar keinen Sinn ergeben.
Sie sind wie die Matheaufgaben, die, vom Lehrer erklärt, so logisch lösbar wirkten, aber nun zu Hause, allein im Zimmer, ein völliges Mysterium geworden sind. In einem Augenblick scheint man zu begreifen, worum es geht, im anderen ist da plötzlich dieses Detail, das nicht ins Gefüge passt.
Und am Ende ist man komplett verwirrt, was das große Ganze angeht. So ungefähr fühlte ich mich gerade und leider saß ich weder in meinem Zimmer noch brütete ich über Hausaufgaben.
Ich hatte nicht geplant, mich im Jungsklo einzuschließen.
Eigentlich war ich nur über die Flure der Schule geschlendert, auf der Suche nach meinem Freund. Aber als die Tür zur Toilette aufging und ich einen kurzen Blick riskieren wollte, da hatte mich jemand im Gedränge auf dem Flur geschubst ... und drin war ich.
Jeder andere hätte sich direkt wieder umgedreht und wäre hinausmarschiert, aber ich stand nur da und riss die Augen auf.
Aus dem Gang drang gedämpftes Gelächter zu mir durch und für einen Moment wusste ich gar nicht, was ich nun tun sollte. Doch noch bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, hörte ich, wie jemand die Klospülung betätigte. Und als plötzlich die Klinke hinter mir gedrückt wurde, da war ich in meiner Panik schnell in eine der Kabinen gehuscht.
Es wäre mir furchtbar peinlich gewesen, von einer Horde Jungs in der falschen Toilette entdeckt zu werden.
Ich bekam in solchen Situationen kaum ein Wort hinaus und fing an zu stottern. Ich wollte schon vor Scham im Boden versinken, wenn ich nur daran dachte, was die Leute hier für Geschichten erzählen würden, wenn ich mit hochrotem Kopf aus der Jungstoilette rennen würde.
Wenn eines an dieser Schule nämlich einwandfrei funktionierte, dann war es die Gerüchteküche.
Ich hatte also hier drin gewartet, bis es wieder leer geworden war, aber gerade als ich das Klo verlassen wollte, da klappte die Tür erneut und einen Moment später vernahm ich die vertraute Stimme meines Freundes.
Ich wollte schon erleichtert aufatmen, aber noch bevor ich die Kabine verlassen konnte, fiel mir auf, dass er nicht alleine war. Mein Freund sprach mit jemandem und ich runzelte die Stirn, als er eine abfällige Bemerkung machte.
Ich hielt inne und überlegte, ob ich ihn auf mich aufmerksam machen sollte, aber dann sagte er auf einmal etwas, das mich stutzig machte.
»Du wirst dich aus meinen Angelegenheiten raushalten.«
Ein dumpfes Geräusch erklang, als hätte er mit der Faust auf das Waschbecken geschlagen. Seine Stimme klang gepresst, aber es schwang auch eine leise Furcht darin mit. Und das war es letztlich, was mich zu der Entscheidung brachte, abzuwarten.
Mit der Hand noch an der Klinke, das Klo bereits aufgeschlossen, hielt ich die Luft an und spitzte die Ohren.
»Was willst du tun, wenn nicht?«, fragte eine deutlich ruhigere und sehr viel tiefere Stimme.
Beim Klang dieser Worte rieselte es mir kalt den Rücken hinunter, denn ich erkannte sofort die Stimme von Alexej Morosow, dem wohl übelsten Menschen, den man hier auf der Schule finden konnte.
Sollte es an irgendeiner Stelle ein Problem geben, dann fand man den Russen garantiert irgendwo mittendrin.
Erst vor ein paar Tagen hatte es auf dem Pausenhof eine große Schlägerei gegeben und nachdem die Lehrer den ganzen Pulk getrennt hatten, fand man natürlich niemand geringeren als Alexej selbst im Zentrum, einen jüngeren Schüler im Schwitzkasten.
Ich wunderte mich einen Moment darüber, weshalb Alexej heute überhaupt hier war. Eigentlich hätte er für das Anstiften einer Prügelei ein paar Tage suspendiert sein sollen.Die Tür wurde erneut aufgestoßen und das Geräusch riss mich aus meinen Gedanken.
Sofort wurde es still im Raum und ich schluckte, weil mir auf einmal bewusst wurde, dass meine Kabine nicht mehr abgeschlossen war. Was, wenn jemand hier hinein wollte? Ich konnte mich ja schlecht dagegen stemmen und wenn ich jetzt den Riegel drehte, hätte das Geräusch mich ohne Zweifel verraten.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich erklären sollte, dass ich mich die längste Zeit hier drin aufgehalten hatte, ohne einen Mucks von mir zu geben. Wie erstarrt stand ich da, unfähig mich zu bewegen, doch bevor ich völlig in Panik geraten konnte, hörte ich, wie der Neuankömmling sich haspelnd entschuldigte und wieder verschwand.
Ich atmete erleichtert auf.Dann hörte ich Alexejs amüsierte Stimme: »Der war ja leicht wieder raus zu befördern. Du hingegen scheinst es noch nicht ganz begriffen zu haben. Du wirst dich von ihr fernhalten.«
Fernhalten? Was meinte er damit?
Doch bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, erhob mein Freund die Stimme erneut, diesmal sichtlich ungehalten: »Sag mal, hast du sie noch alle? Es geht dich einen Dreck an, mit wem ich zusammen bin!«
Ein abfälliges Lachen erklang. »Das denkst auch nur du, Darcy.«
Simon gab ein Schnauben von sich und ich runzelte die Stirn. Mein Freund konnte es nicht leiden, wenn man ihn mit seinem Nachnamen ansprach, aber ich fragte mich unwillkürlich, wie er in einer solchen Lage überhaupt den Mut aufbringen konnte, Alexej die Stirn zu bieten. Jeder hier wusste, wozu der Russe fähig war, wenn er die Beherrschung verlor, und niemand wollte dann im Fokus seiner Aufmerksamkeit stehen.
»Was willst du tun, wenn nicht?«, sagte Simon und ich hielt automatisch die Luft an.
Gespannt starrte ich auf die Kritzeleien und obszönen Sprüche, die meine Klotür verunstalteten, und strengte mich an, jedes noch so leise Geräusch mitzubekommen. Die beiden hatten ihre Stimmen gesenkt, als sie auf mich zu sprechen kamen.
»Dann werde ich dafür sorgen, dass sie sich von dir trennt.« Alexej klang tief und so bedrohlich, dass sogar ich in meiner Kabine versucht war, einen Schritt zurück zu weichen. Ich schluckte, mein Gehirn damit beschäftigt, die Informationen zu verarbeiten, die mir hier geliefert wurden.
»Wenn du versuchst, einen Keil zwischen uns zu treiben, dann wirst du das bereuen«, spie Simon aus und obwohl mein Herz so laut schlug, dass ich Angst hatte, man würde mich hier drin entdecken, hätte ich in diesem Moment am liebsten die Tür aufgerissen und mich neben meinen Freund gestellt, um diesem Alexej zu sagen, wo er sich seine Drohung hinstecken könne.
Was fiel diesem Typen eigentlich ein?
Wie konnte er es wagen, hier aufzutauchen und das Ende meiner Beziehung zu verlangen? Mein Leben ging ihn nicht das Geringste an, und nur weil er sich sonst mit Gewalt durchsetzen konnte, bedeutete das keineswegs, dass jeder hier sich seinem Willen beugte und zu Kreuze kroch, wenn er mit den Fingern schnippte.
Wie dreist konnte man eigentlich sein! Nicht, dass ich ihm das jemals ins Gesicht gesagt hätte.
Ich war mir nur allzu deutlich der Tatsache bewusst, dass ich nicht halb so viel Courage besaß wie mein Freund und ich hoffte insgeheim, dass ich dem Russen niemals persönlich gegenübertreten müsste. Normalerweise machte ich um solch üble Menschen einen großen Bogen und gab mir Mühe, ihren Blick nicht auf mich zu ziehen.
Sehr zu meinem Leidwesen hegte Alexej jedoch eine persönliche Abneigung gegen meinen Freund und diese Feindseligkeit beruhte auf Gegenseitigkeit.
Die beiden konnten sich nicht ausstehen und seit ich mit Simon zusammen gekommen war, hatte er schon mehrmals erwähnt, wie ausfällig der Russe gelegentlich werden konnte. Ich erinnerte mich sogar daran, dass er mich gewarnt hatte, Alexej könne etwas gegen unsere Beziehung haben, was mir bis heute ein ungelöstes Rätsel blieb.
Aber ich hatte noch nie ein Gespräch zwischen den beiden mitbekommen und wenn Alexej immer so ein Arschloch war, dann konnte ich verstehen, weshalb Simon ihm gewöhnlich aus dem Weg ging.
Ich presste die Lippen zusammen und hörte, wie jemand etwas knurrte, diesmal jedoch so leise, dass ich kein Wort verstand, und ein paar Sekunden später verließ Simon, laute Verwünschungen ausstoßend, den Raum. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss und dann war es ruhig.
Ich wagte nicht richtig zu atmen aus Angst, Alexej könnte mich hier drin bemerken.
Es war mir noch nie zu Ohren gekommen, dass er ein Mädchen angepöbelt hätte, aber ich kannte ihn kaum und konnte mir nicht sicher sein, denn es war schwierig, mir ein Bild über ihn zu machen. Er hatte Simon trotz ihrer ominösen Vorgeschichte bisher kaum Beachtung geschenkt, und ich selbst hatte von seinen Eskapaden nicht viel mitbekommen.
In den Klassen verhielt er sich meist ruhig, manchmal etwas abweisend, und schien mit niemandem so wirklich befreundet zu sein. Nun hingegen wurde mir langsam klar, weshalb die Schüler ihm auswichen, wenn er den Gang hinunter kam, und versuchten ihm nicht in die Quere zu kommen.
Was für ein garstiger Mensch.
Ich konnte nur hoffen, dass er bald ginge und ich mich hier herausschleichen konnte. Bestimmt war Simon schon auf der Suche nach mir, damit wir die Mittagsstunde gemeinsam verbringen konnten.
Ich wollte seine Hand nehmen und ihm versichern, dass uns nichts so leicht auseinander bringen könne und er auf die Worte dieses Egoisten nicht hören solle. Als es nach ein paar Minuten noch immer still war, wagte ich es langsam tiefer durchzuatmen.
Dennoch bewegte ich mich nicht vom Fleck und lauschte noch immer angestrengt in den Raum hinein, weil ich mir ziemlich sicher war, dass Alexej noch nicht gegangen war.
Erst als ich kurz davor war, die Geduld zu verlieren, hörte ich schließlich ein Geräusch. Jemand drehte den Wasserhahn auf und schlug sich offenbar Wasser ins Gesicht.
Der Hahn wurde mit einem Quietschen wieder zugedreht und dann hörte ich, wie Schritte den Raum verließen. Eines hörte ich jedoch noch, bevor die Tür schließlich auch hinter Alexej ins Schloss fiel, und das, was ich hörte, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren.
»Du wirst ihn verlassen.«

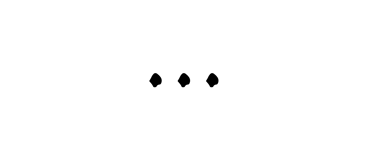
Mit klopfendem Herzen rutschte ich an der Kabinenwand nach unten, bis ich auf dem Boden saß.
Hatte Alexej mich bemerkt? War der letzte Satz direkt an mich gerichtet gewesen, oder hatte er mit sich selbst gesprochen?
Mit langsamen Atemzügen versuchte ich mich zu beruhigen, und als nach einigen Minuten niemand mehr aufgetaucht war, rappelte ich mich schließlich auf und verließ die Kabine.
Ein Blick in den Spiegel offenbarte mir ein blasses Gesicht mit geröteten Wangen und blonde Haare, die in alle Richtungen abstanden. Rasch glättete ich sie und eilte zur Tür, um diese vorsichtig aufzuziehen.
Der Flur war wie leer gefegt. Die meisten Schüler waren mittlerweile beim Mittagessen und hatten Besseres zu tun, als sich hier herumzudrücken. Ich schulterte meine Tasche und ging Richtung Cafeteria, während ich nach meinem Handy fischte.
Als ich es gefunden hatte, sah ich, dass ich bereits zwei Nachrichten von meinem Freund bekommen hatte. Ich hastete die Treppe hinunter ins Erdgeschoss und als ich den großen Saal in der Mitte der Schule betrat, sah ich schon von Weitem, wie meine beste Freundin Sara auf meinen Freund einredete, der lustlos in seinen Nudeln herumstocherte.
»Dina!«, rief sie, als ich in Hörweite gekommen war, und gestikulierte in Simons Richtung, »ist doch so, oder nicht?«
»Was denn?«, fragte ich neugierig, als ich mich gegenüber von Simon niederließ, der mir ein Lächeln schenkte, das seine weißen Zähne entblößte.
Simon sah gut aus mit seiner geraden Nase und den Grübchen, die sich nun vertieften. Am Anfang unserer Freundschaft hatte ich angenommen, dass er sich für Sara interessierte. Sie war eine echte Schönheit und ich fragte mich oft, weshalb er nicht versucht hatte, mit ihr zu flirten.
Jetzt hingegen erschien mir diese Überlegung geradezu lächerlich, wenn ich sah, wie wenig kompatibel die beiden waren. Sein ruhiger Geist war für ihr quirliges Wesen oft viel zu langweilig, während sie ihm gewöhnlich auf die Nerven ging.
Ich erwiderte sein Lächeln, als sein Blick aufgrund meiner grüblerischen Miene fragend wurde und winkte ab. Stattdessen kehrten meine Gedanken wieder zurück zu dem Gespräch, das ich mitgehört hatte.
Irgendwie fühlte ich mich schlecht, weil ich ihn belauscht hatte, selbst wenn es nicht meine Absicht gewesen war. Und ich fragte mich, ob er mich in das Problem einweihen würde. Sara war jedoch gerade dabei etwas zu erzählen, und so suchte ich in meiner Tasche nach meinem Mittagessen, während ich auf ihre Erklärung wartete.
»Du hast kein rotes Cocktailkleid«, sagte sie, verschränkte die Arme und pustete sich eine ihrer rotgoldenen Locken aus der Stirn.
Es war mir schleierhaft, weshalb sie diese bis vor Kurzem kastanienbraun gefärbt gehabt hatte. Ihre natürliche Farbe stand ihr viel besser. Außerdem war ihr Blond sehr viel hübscher als meine aschfarbenen Haare, die zudem in langweiligen Wellen herunterhingen.
Ich musste sie angestarrt haben, denn sie legte den Kopf schief und hob die Augenbrauen, als erwartete sie noch immer meine Antwort. Ich schüttelte meinen Kopf, um meine Gedanken zu vertreiben, und konzentrierte mich auf unser Gespräch.
»Wovon sprichst du?«, fragte ich verwirrt und schaute zwischen den beiden hin und her. »Weshalb sollte ich ein rotes Cocktailkleid haben und wie kommt ihr überhaupt auf das Thema?«
»Na, wegen der Party heute Abend. Simon hat mir gerade erzählt, dass er dich seinen Eltern vorstellen will.«
Mein erstaunter Blick wanderte zu meinem Freund, der mich noch immer lächelnd ansah und nun selbst ein wenig verlegen wirkte. Er hatte mich seinen Eltern nämlich noch nicht vorgestellt und das, obwohl wir schon ein halbes Jahr zusammen waren.
Jedes Mal war ihm irgendetwas dazwischen gekommen und da er ohnehin nicht besonders viel Zeit zur Verfügung hatte, weil er nebenher jobbte, um nicht auf das Geld seiner reichen Familie angewiesen zu sein, gab es nicht besonders viele Gelegenheiten. Aber obwohl es streng genommen Simons Schuld war, dass die Treffen ein ums andere Mal ins Wasser fielen, konnte ich ihm nicht böse sein.
Ich fand es toll, dass er sich nicht alles von seinen Eltern finanzieren ließ, sondern seinen eigenen Beitrag leisten wollte. Trotzdem ging es mir nun doch etwas schnell.
»Heute Abend schon?«, fragte ich.
»Ja«, murmelte Simon und rutschte dabei auf seinem Stuhl hin und her, als wäre es ihm unangenehm. »Es ist mir ganz spontan eingefallen und ich denke, es wird langsam Zeit. Deshalb wollte ich dich heute Abend zu uns nach Hause einladen.«
»Deine Eltern veranstalten die Party?«, fragte ich. Es war das erste Mal, dass ich davon hörte, und meine Fragen schienen Simon zu verunsichern, denn er schaute auf einmal auf seine Hände hinunter und murmelte: »Eine Abendgala, um genau zu sein. Aber du musst natürlich nicht, wenn du keine Lust hast.«
Mir war schon etwas mulmig zumute. Aber obwohl so ein offizieller Anlass mir vor Augen führte, in was für unterschiedlichen Welten wir lebten und ich mich auch ein bisschen davor fürchtete, was seine Eltern wohl zu mir sagen würden, überwog meine Neugierde doch.
Ich wusste nicht viel über die Darcys. Lediglich, dass sie in gehobener Gesellschaft verkehrten. Simons Vater war Partner in einer Kanzlei und seine Mutter arbeitete für verschiedene Modemagazine als Fotografin und Designerin.
Jemand anderes hätte seine Eltern wohl als die typischen Snobs bezeichnet, aber ich hatte einmal miterlebt, wie Simon auf eine solche Behauptung reagierte und als er sich schließlich wieder beruhigte, da hatte ich still für mich beschlossen, lieber gar keinen Kommentar zu seinen Eltern abzugeben. Er schien sie sehr zu lieben und wer war ich, dass ich seine Familie für das Geld verurteilte, das sie besaß?
Einen Moment lang kam der Gedanke in mir auf, ob er auf die Idee mit der Einladung gekommen war, weil er Alexej beweisen wollte, dass er sich nicht von mir trennen würde. Aber selbst wenn es so wäre, freute ich mich trotzdem darüber, dass er nicht vergessen hatte, wie wichtig es mir war, seine Welt etwas besser kennenzulernen.
»Natürlich komme ich«, sagte ich nun also und Simon fand sein Lächeln wieder. »Aber vorher muss ich auf jeden Fall ein Kleid besorgen, denn Sara hat recht, so was habe ich nicht.«
»Ich dachte wirklich, du hättest eines«, murmelte er, zuckte mit den Schultern und machte sich nun doch noch über seine Nudeln her.
Ich musste grinsen, als ich sah, dass er seinen Appetit wieder gefunden hatte, und biss in mein Sandwich.
»Wo warst du eigentlich vorhin?«, fragte da Simon plötzlich mit vollem Mund. »Ich hab dich nirgendwo gesehen.«
»Ich hab dich gesucht«, antwortete ich und ließ meinen Blick über sein Gesicht wandern. Eigentlich hatte ich angenommen, dass er nun mit der Sprache herausrücken würde, aber er sagte nichts weiter und das machte mich unsicher.
»Wo warst denn du?«, fragte ich nun behutsam.
»Hatte was im Schulzimmer vergessen.«
Ich starrte auf mein Sandwich hinunter, während ich darauf wartete, dass er noch mehr sagte, aber Simon aß einfach weiter und so ließ ich die Sache schließlich auf sich beruhen.
Das belauschte Gespräch lag mir schwer im Magen und es lag mir auf der Zunge, meinem Ärger Luft zu machen und Simon zu fragen, wieso Alexej ihn so sehr hasste, aber irgendetwas sagte mir, dass ich lieber die Klappe halten sollte. Simon hatte sich immer davor gedrückt, mir zu erzählen, was in der Vergangenheit zwischen ihm und diesem Unruhestifter vorgefallen war, und ich wollte ihn nicht bedrängen und damit möglicherweise alte Wunden wieder aufreißen.
»Okay«, rief Sara plötzlich und schlug so heftig auf den Tisch, dass ich mich vor Schreck verschluckte und hustend nach meiner Wasserflasche griff.
»Wir beide, Schnucki«, sie pikte mir mit dem Finger in die Brust, »gehen nachher auf Kleiderfang. Ich will die Freistunde nach dem Mittag nutzen, um die Geschäfte in der Nähe abzuklappern, und wenn wir dort nichts finden, gehen wir nach der Schule in die Stadt. Wäre ja gelacht, wenn wir bis heute Abend kein Kleid auftreiben können!«
Oh Gott.
Eigentlich hatte ich die lange Mittagspause mit Simon verbringen wollen, wie wir das immer taten, da er freitags eigentlich arbeiten musste und wir deshalb am Abend keine Zeit füreinander hatten.
Aber jetzt, da er sich freigenommen hatte, um mit mir auf die Party zu gehen, konnte ich das kaum als Ausrede bringen.Außerdem würde mir die Zeit mit Sara helfen, meine negativen Gedanken loszuwerden, denn meine beste Freundin kaufte leidenschaftlich gerne ein und würde mich herumscheuchen, bis wir das perfekte Kleid gefunden hatten.
Ich seufzte also ergeben und nickte.
»Super«, grinste sie und klatschte in die Hände. »Das wird super!«

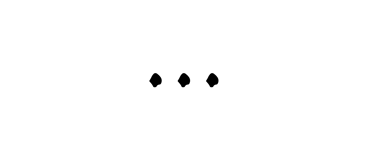
Es war grauenvoll.
Aber zumindest war ich in meiner Misere nicht allein, denn Simon hatte sich letztlich dazu überreden lassen uns zu begleiten.
Eigentlich konnte er so etwas noch viel weniger leiden als ich, aber auf Saras Drängen hin und unter meinem bittenden Blick hatte er schließlich nachgegeben.
Nun stand ich mit dem geschätzten tausendsten Kleid vor der Umkleidekabine in einem Laden, der zum Glück nicht weit von unserer Schule entfernt war, und war selbst dabei die Lust zu verlieren.
»Findest du es nicht etwas zu übertrieben?«, fragte ich meinen Freund. Ich drehte mich ein wenig hin und her, um ihm eine bessere Sicht auf das Kleid zu gewähren, während ich selbst skeptisch in den Spiegel starrte. Bereits seit einer halben Stunde schlüpfte ich in verschiedene Sachen, die irgendwie alle nicht so richtig meinem Geschmack entsprachen.
»Nein, das Kleid steht dir gut«, kam es von Simon, der auf dem Hocker in der Ecke saß und den Einkaufsexzess über sich ergehen ließ.
»Meinst du?«Das Kleid saß ziemlich eng und ich fragte mich, ob ich darin nicht doch etwas dicker aussah, als ich eigentlich war. Ich war nicht pummelig, aber die Raffung an der Taille trug doch ziemlich auf und die Farbe machte mich blass.
Sara unterdessen schleppte unermüdlich neue Kleider an und war gerade erst wieder zwischen ein paar Kleiderstangen verschwunden.
»Ich weiß nicht, Simon. Bist du sicher, dass es nicht etwas zu overdressed aussieht?« Nachdenklich strich ich über den weichen Stoff, während ich auf Simons Urteil wartete. Als dieses nicht kam, blickte ich irritiert auf, nur um ihn dabei zu erwischen, wie er gähnte.
»Simon!«Die Zeit lief uns davon und ich hatte keine Lust darauf, nach der Schule erneut auf die Suche zu gehen. Außerdem fühlte ich mich unsicher in diesen Kleidern und fragte mich ständig, was seine Eltern wohl denken würden, wenn ich mich selbst schon so fühlte, als würde ich in einer Wurstpelle stecken.
»Du bist wirklich nicht gerade hilfreich!«, motzte ich ihn deshalb an, als er mir einen unschuldigen Dackelblick zuwarf. »Ich probiere jetzt schon das tausendste Kleid an und du sagst immer nur, dass es gut aussieht. Wie soll ich da eine Wahl treffen?«
Simon seufzte und strich sich durch die dunkelblonden Haare. Meine Laune sank langsam aber sicher, denn ich glaubte in seinem Seufzen einen ungeduldigen Unterton zu vernehmen.
Er hatte meine Eltern schließlich schon am Anfang unserer Beziehung kennengelernt und dabei nichts weiter tragen müssen als sein übliches Poloshirt und seine Lieblingsjeans.
»Du siehst eben in allem gut aus, Knuffelchen«, sagte Simon jedoch nur und kam zu mir, um mich mit seinen braunen Teddybäraugen anzuschauen. »Es sind nur sehr viele Kleider gewesen und ich weiß auch nicht mehr, was ich noch sagen soll.«
Er strich mir über die Schultern und gab mir einen kurzen Kuss. Ich schloss die Augen, als ich mich an ihn lehnte und der Geruch seines Parfüms mir in die Nase stieg. Er streichelte mir über den Rücken und ich seufzte.
Simon mochte es eigentlich nicht, öffentlich Zärtlichkeiten auszutauschen, und deshalb waren solche Momente selten.
»Weißt du was«, murmelte ich, als ich mich von ihm löste. »Ich nehme ganz einfach das erste Kleid. Das war gar nicht schlecht, oder?«
»Egal, was du nimmst, es sieht sicher gut aus.«
Ich grinste und wühlte in dem großen Stapel herum.Zurück in der Umkleidekabine, pellte ich mich aus dem engen Kleid. Wieder in meinen Jeans und der leichten Bluse fühlte ich mich gleich viel besser. Ich betrachtete das auserwählte Kleid noch einmal, das eine dunkelblaue Farbe besaß und leichte Verzierungen am Ausschnitt hatte. Die geschnürte Rückenpartie sah zwar elegant, aber nicht zu übertrieben aus und gab dem Kleid das gewisse Etwas.
Ich nickte. Als ich aus der Kabine kam, war Simon schon wieder am Gähnen, hielt sich aber schnell die Hand vor den Mund und hatte den Anstand, einen schuldbewussten Blick aufzusetzen.
Ich schüttelte mit einem Lächeln den Kopf. Irgendwie konnte ich ihm nicht böse sein. Er hatte mir in jedem einzelnen Kleid Komplimente gemacht und beteuert, wie hübsch er mich fand.
»Dein Martyrium ist hiermit offiziell beendet«, flötete ich also und konnte ein Grinsen nicht unterdrücken, als die Erleichterung ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben stand. Aber wir mussten eh bald gehen, um pünktlich zurück in der Schule zu sein.
»Ich räum das hier nur schnell weg«, sagte ich und hob den Stapel hoch, den ich bis jetzt durchprobiert hatte.
In diesem Moment kam Sara von irgendwoher aus dem Getümmel der Leute, einen weiteren großen Berg Klamotten in der Hand.
»Nichts da«, rief Simon, bevor ich reagieren konnte, und scheuchte sie wieder weg. »Sie hat eins.«
Ich kicherte und glaubte ihn noch ein ›Gott sei Dank‹ murmeln gehört zu haben, als ich von dannen schritt, um auch meiner Qual ein Ende zu setzen. Das mulmige Gefühl beim Gedanken an die Party war verschwunden und ich lächelte auf meine Einkaufstasche hinunter.
Auf einmal freute ich mich darauf, das Kleid heute Abend zu tragen.
Ich konnte ja nicht wissen, dass es niemals dazu kommen würde.
Kapitel 2 - Die Sache mit der Spinne
Es bringt gewisse Vorteile mit sich, ein Lehrerliebling zu sein.
Der Begriff mochte nicht besonders schmeichelhaft sein, aber für mich war es alles andere als unangenehm, die Lehrer auf meiner Seite zu wissen. Wenn man beispielsweise zu spät kam, drückten sie gerne mal ein Auge zu und wenn man aufgerufen wurde und die Antwort auf eine Frage nicht kannte, dann folgte meist nur ein Nicken und der Nächste durfte sein Glück versuchen.
Ich fand jedenfalls nichts Schlimmes daran und meine Mitschüler schien es auch nicht zu stören.
Selbstverständlich gab es auch an unserer Schule Fälle von Mobbing, aber ich durfte mich glücklicherweise zu den Leuten zählen, die eigentlich mit allen gut auskamen und im Grunde nicht sonderlich aus der Menge herausstachen.
Eines durfte man dabei aber nicht vergessen.
Nämlich, dass ein solcher Ruf manchmal auch gewisse Nachteile mit sich bringt.
Jetzt gerade zum Beispiel wäre ich lieber einer der Schüler gewesen, die von den Lehrern mit grimmigen Blicken taxiert wurden, wenn sie sich ein paar Minuten zu spät zur Tür hereinschoben oder um einen Aufschub für eine Arbeit baten. Solche Schüler wurden nämlich nicht gebeten, nach dem Geschichtsunterricht zu bleiben, um die alten Karten zurück in die Bibliothek zu bringen.
Ich jedoch wurde soeben mit einem ganzen Stapel davon beladen, sodass ich meine Tasche schließlich auf einen leeren Stuhl warf, um die Arme frei zu haben.
Den ganzen Nachmittag verspürte ich schon eine stille Vorfreude auf den heutigen Abend. Doch leider hatte ich diese mit niemandem teilen können, weil sowohl Sara als auch Simon andere Fächer belegt hatten. Genau genommen hatten sie nach einer Doppelstunde Englisch sogar bereits vor einer Stunde nach Hause gehen können, während ich hier auch nach Schulschluss noch aufgehalten wurde.
Herr Maibachs Gedanken weilten bestimmt auch schon beim Wochenende und da bot es sich natürlich an, seine Arbeit auf einen Schüler abzuwälzen. Die Karten mussten in den Keller gebracht werden, wo sich die Alte Bibliothek befand, wie wir Schüler sie nannten, und dazu musste man einmal quer durch die Schule.
»Die Karten sind sehr empfindlich, Dina«, wurde ich angewiesen, als ich sämtliche Dokumente in den Händen hielt, die mein Geschichtslehrer zu Anfang der Stunde angeschleppt hatte. »Es ist wichtig, dass sie im Keller lagern, wo es kühl und trocken ist.«
Ich nickte abwesend, während ich mir die Wegbeschreibung anhörte.
Niemand ging je in den Keller.
Niemals.
Die Bibliothek war nämlich schon vor Jahren ins Obergeschoss verlagert worden und im alten Gewölbe wurden ausnahmslos die empfindlicheren und wertvolleren Studienobjekte aufbewahrt, die man zur Sicherheit nicht in die neue Bibliothek verlagert hatte, wo tagtäglich viele pflichtbewusste – oder gezwungenermaßen fleißige – Schüler ihre Finger daran wetzen konnten.
Mehr oder minder begeistert machte ich mich auf den Weg.
Je früher ich meine Last abliefern würde, desto schneller käme ich schließlich auch hier raus. Ich ging wie beschrieben erst einmal ins Nebengebäude und dort die Haupttreppe ganz nach unten. Nach mehrmaligem Abbiegen entdeckte ich die schmale Treppe, die so aussah, als wäre sie im letzten Jahrhundert gebaut worden.
Es war kühl hier unten, was ja auch Sinn und Zweck der Sache war, und die Treppe war steil, sodass ich aufpassen musste, wo ich hintrat. Endlich, nachdem ich ohne Erfolg in ein paar leer stehende Räume und den Heizungskeller hineingespäht hatte, erblickte ich am Ende eines engen Durchganges die grüne Metalltür, nach der ich suchte.
Ich ging den Gang hinunter, stieß sie auf und blickte in einen dämmrigen Raum. Das Licht funktionierte nicht, obwohl ich den altmodischen Kippschalter mehrmals betätigte. Ich zuckte nur mit den Schultern und schritt zu einem der Tische, während die Tür hinter mir mit einem lauten Klacken ins Schloss fiel.
Ich warf die Karten auf den einzigen freien Platz, den ich finden konnte, und machte auf dem Absatz kehrt. Wenn ich mich beeilte, dann konnte ich vielleicht sogar den Bus noch erwischen und musste nicht eine halbe Stunde auf den nächsten warten.
Ich griff nach dem Türknauf und zog.
Nichts bewegte sich.
Irritiert runzelte ich die Stirn und zog noch einmal, diesmal mit mehr Kraft. Die Tür musste klemmen, denn sie bewegte sich keinen Millimeter. Selbst dann nicht, als ich mit beiden Händen zupackte und daran rüttelte. Ich blickte verwirrt auf den Knauf hinunter.
Langsam stieg eine furchtbare Ahnung in mir hoch. Diese Vermutung war so erschreckend, dass ich augenblicklich losließ und einen Schritt zurücktrat.
»Nein, das kann nicht sein«, murmelte ich.
Ich starrte auf die alte Kellertür, als würde sie mir meine unausgesprochene Frage beantworten können. Hatte ich mich eingeschlossen?
Mein Blick wanderte über die grüne Farbe, die bereits an vielen Stellen abblätterte und das hässliche kalte Metall preisgab, während die Gedanken in meinem Kopf zu rattern begannen.
Wieso hatte Herr Maibach nicht erwähnt, dass sich die Tür von innen nicht würde öffnen lassen? Das konnte er doch nicht vergessen haben? Hatte ich ihm vielleicht nicht richtig zugehört?
Ich erinnerte mich, dass ich mehrmals ungeduldig genickt hatte, als er mir den Weg erklärte, überzeugt davon, dass ich den richtigen Raum schon finden würde, wenn ich die Augen offen hielt. Nun kam ich mir dumm vor, weil ich nicht einmal sagen konnte, ob dieses Missgeschick hier meine Schuld war oder das Versäumnis meines Geschichtslehrers.
In einem letzten Anflug von Entschlossenheit packte ich den Knauf noch einmal und rüttelte mit aller Kraft. Doch die Tür gab nicht nach. Kein Knirschen, kein Knacken oder sonst ein Anzeichen dafür, dass sie mit genügend Willen aufzustemmen wäre.
»Oh mein Gott«, entkam es mir leise. Ich hämmerte mit der Faust gegen die Tür, aber ich tat mir nur selber weh und so klopfte ich schließlich mit der flachen Hand dagegen.
»Hallo?«, rief ich und lauschte. »Ist da jemand!«
Nichts rührte sich.
Ich stöhnte frustriert auf. Ausgerechnet heute, wo ich Simons Eltern endlich kennenlernen sollte. Wahrscheinlich würde ich viel zu spät und total abgekämpft dort ankommen, denn wer konnte schon sagen, wie lange es dauern würde, bis mein Geschichtslehrer auf die Idee kam, nach mir zu sehen.
Ich seufzte, drehte mich um und lehnte mich gegen das kalte Metall. Schweigend ließ ich meinen Blick über das Durcheinander schweifen, das hier unten herrschte. Überall stand Zeug herum. Plastikstühle, Standgloben und jede Menge alter Schreibtische, an die sich teils windschiefe Regale lehnten, die mit scheinbar letzter Kraft die alten Wälzer und staubigen Karten vergangener Zeiten auf ihren durchgebogenen Brettern trugen.
Das Licht hier drin war trüb.
Nur durch ein paar kleine Fenster oben an den kahlen Betonwänden sickerten ein paar spärliche Sonnenstrahlen in den Raum. Viele kleine Staubpartikel tanzten im goldenen Abendlicht und ich fragte mich unwillkürlich, wann die Sonne heute wohl untergehen würde.
Der Herbst hatte vor kurzem Einzug gehalten und obwohl es tagsüber noch relativ mild war, wurden die Nächte kalt und kamen früh, sodass ich schon sehr bald im Dunkeln sitzen würde.
Ich schauderte bei dem Gedanken.
Ärgerlich schüttelte ich den Kopf. Es bestand überhaupt kein Grund mich zu fürchten. Ich würde hier garantiert nicht den ganzen Abend verbringen. Schließlich lag meine Tasche noch in Herrn Maibachs Klassenzimmer. Die Tasche, in der dummerweise auch mein Handy steckte.
Ich schlang die Arme um mich selbst, als mir in den Sinn kam, dass ich sie auf einen Stuhl geworfen hatte. Was, wenn er sie nicht bemerkte?
Ein dumpfer Kopfschmerz begann sich zu melden und ich rieb mir über die Schläfen. Es würde mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu warten.
Und so wartete ich.

Ich wartete lange.
Es gab kaum Geräusche hier unten, was einen fertig machen konnte. Nichts, was einen aus der öden Lethargie des Wartens herausholen könnte.
Ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit bereits verstrichen war. Ich saß schon so lange hier unten, dass ich jegliches Gefühl für entschwindende Minuten verloren hatte. Es war dunkler geworden und ich wusste nicht, ob ich es mir einbildete, aber ich hatte das Gefühl, es würde auch kälter werden.
»Liebe Dina«, äffte ich meinen Lehrer in einem Anflug von Ärger nach, »diese Karten müssen unbedingt in den Keller, weil sie sonst Schaden nehmen könnten. Es ist besser für sie dort unten. Kühl und trocken!«
Ja, verdammt, fügte ich in Gedanken an. Und eng und muffig.
Hier unten roch es nach Staub und abgestandener Luft und auch wenn ich mich ansonsten gerne an solchen Orten aufhielt, an denen längst vergessene Schätze gelagert wurden, die man erforschen und bewundern konnte, bevorzugte ich doch eher Räume, die ich auch wieder verlassen konnte, wenn die Nacht hereinbrach.
Der Zeitpunkt, an dem ich dieses Gewölbe verlassen hätte, lag allerdings schon ein gefühltes Jahrhundert hinter mir. Ich fragte mich, ob man mich nicht schon irgendwo vermissen müsste. Im Geiste ging ich die Personen durch, die sich wundern könnten, wo ich abbliebe.
Sara konnte ich schon einmal vergessen. Meine beste Freundin glaubte, dass ich unterdessen zu Hause wäre und mich für die Party schick machte. Meiner Mutter konnte meine Abwesenheit gar nicht auffallen, weil sie in der Pflege arbeitete und heute Spätschicht hatte.
Ob mein Vater sich fragte, wo ich bliebe? Bestimmt nicht, wenn man bedachte, dass ich nach der Schule oft noch zu Sara nach Hause ging.
Simon hingegen würde mich bestimmt bald anrufen, um sicher zu gehen, dass ich die Zeit nicht vergaß. Er hasste Unpünktlichkeit und deshalb hatte ich mir auch angewöhnt ihm zu schreiben, selbst wenn es sich bei der Verspätung nur um wenige Minuten handelte. Heute würde er sich wahrscheinlich von selbst melden, lange bevor die Party begänne.
Er hatte so getan, als wäre das keine große Sache für ihn, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er genau so nervös war wie ich. Ich fragte mich, was er tun würde, wenn ich mich nicht meldete. Ob er auf die Idee kommen würde, dass ich noch hier sein könnte?
Das erschien mir ziemlich abwegig.
Wieder entrang sich mir ein tiefes Seufzen. Langsam aber sicher glaubte ich nicht mehr daran, dass noch jemand kommen würde. Selbstmitleid kam in mir auf und wilde Szenarien fingen in meinem Kopf an lebendig zu werden.
Es war schließlich Freitag und bis man mich finden würde, könnte es Montag sein. Wer wusste schon, ob Herr Maibach nicht übers Wochenende zu seiner Familie führe, die bei meinem Glück selbstverständlich irgendwo lebte, wo es kein fließendes Wasser gäbe und natürlich auch keinen Telefonanschluss.
Ich würde hier drin verdursten, verhungern und erfrieren! Gut, vielleicht nicht alles auf einmal, aber auf jeden Fall verdursten. Am Montagmorgen würde man mich ausgetrocknet hier an der Tür finden, wo ich mir die Finger blutig geschrammt hatte in dem Versuch, meinem Gefängnis zu entkommen.
Okay, das war vielleicht etwas zu melodramatisch und ja, vielleicht auch ein wenig lächerlich. Ich zog eine Grimasse und rappelte mich auf. Ich durfte hier nicht herumsitzen, bis ich am Ende noch die Krise kriegte.
Solange ich noch ein wenig Licht hatte, würde ich mich hier lieber etwas umsehen. Vielleicht gab es ja eine Möglichkeit, hier auf unkonventionelle Weise heraus zu kommen. Entschlossen quetschte ich mich zwischen einem Tisch und einem staubigen Regal hindurch. Obwohl hier nicht mehr so viele Gegenstände gelagert wurden wie früher, wirkte der Raum doch vollgestopft.
Mit zunehmender Gelassenheit stellte ich fest, dass es nicht halb so gruselig war, wie ich gedacht hatte. Im letzten Licht der Abendsonne sah sogar alles ein wenig verwunschen aus.
Wie lächerlich, dass ich einen Moment zuvor noch geglaubt hatte, möglicherweise hier drin drauf gehen zu müssen.
Ich ging an verschiedenen Regalen entlang und strich über die alten Buchrücken.Als nach ein paar Metern eine Lücke auftauchte, wo jemand ein paar dicke Wälzer entfernt hatte, fiel mein Blick durch die Bretter hindurch plötzlich auf einen Wasserhahn über einem weißen, großen Plastikwaschbecken. Gott sei Dank. Ich würde also doch nicht verdursten. Zumindest nicht, wenn der Anschluss nicht zugedreht wäre. Ich kletterte über einen niedrigen Tisch neben dem letzten Büchergestell.
Das Glück war endlich einmal auf meiner Seite.
Ich lachte und packte den grünen Hahn, um das Wasser aufzudrehen, als auf einmal alles ganz furchtbar schnell ging.
Ich entdeckte die haarige Spinne, die auf dem Hahn ihr Netz gesponnen hatte. Ich stürzte zurück gegen ein Regal und schlug wild mit den Armen um mich, schreiend und panisch, um das ekelhafte Getier abzuschütteln, als ich plötzlich hörte, wie die Tür zur Bibliothek aufging.
Schockstarr und mit stummem Entsetzen hörte ich, wie jemand meinen Namen rief. Ekelschauer liefen mir über den Rücken, doch ich stolperte vorwärts. Ein fürchterlicher Gedanke durchzuckte mich ...
Die Tür. Sie durfte nicht zufallen!
»Die Tür!«, schrie ich und krachte gegen den Schreibtisch. »Pass auf, die Tür!«
Und dann hörte ich das Klacken.
Wie ein Donnerschlag, so laut klang es in meinen Ohren, während ich vor Schrecken bleich, die Hand dramatisch ausgestreckt, erstarrte. Ein Moment unbeschreiblicher Stille folgte dem endgültigen Ton und die Information über das eben Geschehene sickerte langsam in meinen Verstand.
Doch bevor ich völlig begriffen hatte, was eigentlich los war, fiel mein Blick auf den Rücken mit den breiten Schultern und eine andere Gewissheit schlug so heftig ein, dass mir das frustrierte Stöhnen im Hals stecken blieb.
Ich kannte diese breiten Schultern.
Ich kannte diese Gestalt.
Groß. Dunkelhaarig. Aggressiv.
Stöhnend sackte ich in mich zusammen und stützte mich auf der staubigen Tischplatte ab.
Das durfte doch wirklich alles nicht wahr sein.